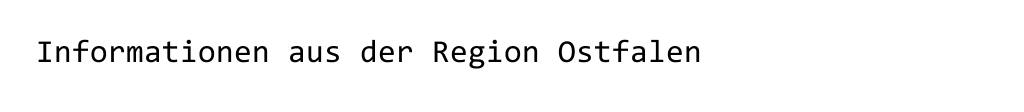( Helmstedter Kreisblatt / Aus der Heimat – Für die Heimat vom 14.Mai 1966 / Robert Schaper)
Als die Helmstedter im Zuge des Wiederaufbaues ihrer Stadt zu Beginn des 13. Jahrhunderts die große Stadtmauer errichteten, bauten sie, entsprechend den großen Heer- und Handelsstraßen die die Stadt durchschnitten, vier Tore, und jedes derselben krönten sie mit einem Turm. Die Benennungen dieser Türme waren zunächst einfach. Da sie nach den vier Himmelsrichtungen hinausführten, wurden sie auch nach diesen genannt . Erst später kamen andere Bezeichnungen hinzu. So hieß das Südertor auch Seepertor - als Abkürzung für Seedorfer Tor; denn die beiden Dörfer Groß- und Klein-Seedorf lagen zunächst an der Straße, die aus dem Tore führte. Das Ostertor bekam nach der Lage am Kloster auch die Bezeichnungen Klostertor oder Ludgeritor, und nach der nächsten Stadt, wohin die Straße führte, auch Magdeburger Tor. Auch das Westertor hatte viele Namen. Neumärker Tor oder Braunschweiger Tor sind ja durch die Lage erklärt. Nur das Nordertor hatte weiter keinen Namen, trotzdem es in älteren Zeiten wichtiger als das Westertor war.
Die Türme über diesen Toren waren unterschiedlich in Bau und Höhe. Der Kupferstich den Merian um 1650 anfertigte, zeigt das noch deutlich. Am höchsten ragte der Neumärker Torturm empor. Das "Magdenburgisch Tor" war wohl in demselben Stil erbaut, aber augenscheinlich an Höhe geringer. Ganz anders stellt sich das "Seedorfer Tor" dar. Es ist ein verhältnismäßig niedriger, quadratischer Steinklotz mit flachem Dach und Zinnen darauf. Der Turm über dem Nordertor ist nicht bezeichnet.
An der jetzigen Magdeburger-Straße war das Oster- oder Ludgeri Tor.
Das Südertor, diese Darstellung wird wegen der gegenteiligen Beschreibung angezweifelt.
Das mag daran liegen, daß er auch unscheinbarer als der Südertorturm war und dem Zeichner von seinem Standpunkt aus gar nicht auffiel. Er ist sicherlich noch vorhanden gewesen. Hundert Jahre später allerdings wird der in dem "Corpus bonorum der Raths Cämmerei" von 1745, dem Verzeichnis der städtischen Liegenschaften und Güter nicht mehr erwähnt. Vielleicht ist er auch schon während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges zerstört worden. Auch der General-Superintendent und erste Prediger an der St. Stephanikirche, Friedrich August Ludewig, der 1821 eine "Geschichte und Beschreibung der Stadt Helmstedt“ herausgab, schreibt in diesem Werk: "Sonst waren auf allen Thoren Thürme, der auf dem Norderthore ist schon seit langer Zeit nicht mehr vorhanden". Er wußte auch nicht zu sagen, wann er abgerissen worden ist.
Von dem Ludgeri-Torturm sagt Ludewig: "Das Niederreißen des auf dem Osterthore befindlichen Thurmes ist schon bestimmt und wird nächstens vor sich gehen". Auf dem Oster- und dem Westerturm hatten "die so genannten zwey Bierspünder die freye Wohnung, weil sie als executores bey Real- und Personal-Arretirungen mit gebraucht werden "loco salari" Die Bezeichnung "Bierspünder stammt aus dem Mittelalter. Damals hatten diese vom Rat angestellten Leute das Offnen der Bierfässer unter der Aufsicht eines dazu bestimmten Ratsherrn vorzunehmen, um der Defraudation von Bieraccise vorzubeugen. Im 18. Jahrhundert war diese Angelegenheit mehr oder weniger gegenstandslos geworden, und so beschäftigte der Rat diese Leute als Stadtbüttel bei der Beschlagnahme von Sachen und Verhaftung von Personen. An Stelle einer Entschädigung dafür - loco salari - hatten sie freie Wohnung auf einem der Tortürme.
Um möglichst hohe Einnahmen für die städtische Kämmerei zu erzielen, hatte Herzog Carl I. von Braunschweig dem Helmstedter Rat aufgegeben, alle stadteigenen Gärten und Wohnungen bei Verpachtungen zu subhastieren, das heißt an den Meistbietenden (plus licitans) zu vergeben. Die Bierspünder hatten aber auch noch das Amt des Torschließers zu versehen. Aber "weil nun nicht ratsam ist, daß ein jeder plus licitans auf die Therme ziehe, auch die Thorschließer billig nahe bey den Thoren wohnen müßen, so haben des Herrn Hertzogs Carln Durchlaucht am 7. Januar 1745 gnädigst beliebt, daß es dieserhalb bey der bisherigen Verfassung bleiben und diese Stuben nicht subhastirt werden sollen".
Aus dem Jahre 1818 ist uns auch eine Beschreibung des Ostertorturmes bekannt, danach maß er 27 Fuß im Quadrat und war 45 Fuß hoch, "massiv aufgemauert, das Dach ein Satteldach und hat zwey Walme, mit Breitziegel bedeckt, die First und Ecken mit Hohlziegel belegt". Bei einer Breite von 7,70m war es also 12,82m hoch. "Unten in diesem Thurm ist eine Durchfahrt mit zwey Bogen und inwendig mit einem Gewölbe versehen". In der zweiten Etage war die Wohnung des Torschließers, die aus einer Stube und "einem kleinen Behältnis zur Küche" bestand, während das dritte und vierte Stockwerk je einen Gefängnisraum enthielt. Das ganze Gebäude wurde eingehend bis ins einzelne geschätzt und dabei kam der Amtszimmermeister Christoph, Theodor Koch auf die Summe von 275 Thalern, die den Wert der Steine und des Holzes darstellten. Der Abbruch wurde zu 80 Thalern bei rechnet, allerdings ohne Abfuhr des Abfalls.
Es dauerte aber noch einige Jahre, bis der Abbruch spruchreif wurde. Im Mai 1821 meldete sich der Apotheker Dr. August Lichtenstein, der das Haus des Seifensieders Rickert am Papenberge gekauft hatte, um es abzureißen und von Grund auf neu zu bauen. In seinem Schreiben an den Bürgermeister betonte er, daß er "alles mögliche anwenden werde, um durch dies neu zu erbauende Haus den Marktplatz und die Stadt zu verschönern". Zu diesem Zwecke aber möchte er den Ostertorturme kaufen, der, wie er gehört hätte, abgebrochen werden solle. Er wolle 150 Thaler für Material, Abbruch und Abfuhr zahlen.
Aber so leicht sollte ihm der Kauf nicht werden. Auf den 8. Juni wurde der Verkauf angesetzt, den Zuschlag sollte der Meistbietende bekommen. Der Unterschied der Gebote betrug nur einen Thaler; Lichtenstein bot 181, der Maurermeister Linke 182 Thaler. Nach einigem Schriftwechsel, in dem sich Lichtenstein erbot, zweihundert Taler zu geben, bekam dann doch Linke den Zuschlag. Wenn Lichtenstein auch schrieb, daß ihm "die Steine dieses Thurmes unumgänglich nötig seien", wenn er seinen Bau so ausführen wolle, wie der Riß angefertigt sei, so hat er auch ohne diese Steine vom Ostertorturme ein schönes Haus erbauen lassen, das noch heute eine Zierde der Stadt ist, die Ratsapotheke.
Der Ostertorturme verschwand jedenfalls, und zwar noch im Jahre 1821. Den Südertorturm hatte kurze Zeit vorher das gleiche Schicksal ereilt. Ludewig schrieb 1821: "Der Thurm auf dem Seedorperthor ist vor kurzem abgerissen". Noch im Jahre 1817 hatte man daran gedacht, ihn stehen zulassen und die Durchfahrt zu erhöhen, "da von den hiesigen Ackerbau treibenden Einwohnern dringend darum nachgesucht worden, daß der Thurm schon in dem bevorstehenden Frühjahre verändert werden möge, damit während der diesjährigen Erntezeit bereits ein gehörig beladener Kornwagen das Thor passieren könne, welches jetzt nicht der Fall ist".
Der Amtszimmermeister Christoph Theodor Koch berechnete den Umbau auf 172 Thaler, während der Abbruch nach seinen genauen Berechnungen 155 Thaler einbringen mußte. Der Turm war 22,1/2 Fuß lang und 24,1/2 Fuß breit, maß also 6,30 m x 4,85 in und war 32 Fuß (9,12 m) hoch. Die zweite Etage enthielt Stube und Kammer und wurde von dem Torschließer bewohnt. Eine Schwierigkeit, damals wie heute, war noch zu überwinden: man mußte für den Torschließer eine andere Wohnung finden. Aber das regelte sich vorher: er bekam eine Stube "in dem alten Schulhause" (hinter der Stephanikirche), und der Leineweber Wachtmann, der ganz in der Nähe des Südertores wohnte, übernahm den Dienst hier.
Der Abbruch des Turmes geschah dann ganz rasch. Am 18. Mai 1820 erkannte das Fürstliche Kammerkollegium in Braunschweig den Abbruch als notwendig an, und am 19. Juni konnte der Bürgermeister Ferber bereits schreiben, daß "der hiesige Süderthorthurm nunmehr abgebrochen" worden sei. Aber nun stellten sich Nachfolgeerscheinungen ein. Von dem abgebrochenen Turm bis zum Walle zog sich eine enge Straße, hin, die zu beiden Seiten von der Stadtmauer eingeschlossen, wurde. Die Mauer war winklig, ungleich hoch und schadhaft, und die Stadtverwaltung dachte daran, diese Mauer in weiterer Entfernung voneinander und geradlinig wieder aufzubauen, um einen breiteren und schöneren Zugang zur Stadt zu haben. Aber da war das Kammerkollegium, weitsichtiger. Es habe "nichts dabei zu erinnern, daß diese Avenue erweitert und egalisiert" werde, heißt es in einem Schreiben vom 14. Juli 1820, jedoch meinten die Herren, "daß es kostensparend sei und zur Verschönerung der Avenue beitragen würde, wenn statt einer wiederum aufzuführenden Mauer ein geschmackvolles, demnächst zu vermalendes Stackett in der Art wie auf der hiesigen - Braunschweiger - Wallpromenade vorgerichtet würde".
So wurde denn die Mauer abgebrochen — aber erst im nächsten Jahr. Denn der städtische Haushalt gab dafür nichts mehr her. Und dann wurden die Ortsvorsteher der Nachbargemeinden Büddenstedt und Runstedt noch gebeten, den Schutt abzufahren, weil die Erweiterung "nicht sowohl zur Verschönerung Helmstedts selbst, als besonders auch zur Bequemlichkeit der Einfahrt sämtlicher Bespannten Ihrer Commune gereichen und es daher zugleich von demselben gewiß gern gesehen wird, daß sothane Erweiterung diesseits veranstaltet werde". So halfen denn auch einige Fuhrwerke aus den genannten Dörfern, den Schutt nach dem Brunnenweg zu fahren, um diesen zu befestigen.
Die Stelle des ehemaligen Südertorturmes und der von der Mauer eingenommene Platz haben sich aber im Laufe von mehr als einem Jahrhundert grundlegend geändert. Der Kreisdirektor von Heinemann machte dazu den Anfang, als er bald darauf das im streng klassizistischen Stil gehaltene Haus erbauen ließ, das heute noch Sitz der Kreisverwaltung ist, und um die Jahrhundertwende wurde dann das große Wohnhaus zwischen Batteriewall und Wilhelmstraße errichtet. Der große freie Platz entstand aber erst mit dem Bau des heutigen Osterwaldschen Hauses und dem Gebäude der Staatsbank im Jahre 1907. Nur der Hausmannsturm ist von allen vier Tortürmen in seiner alten Schönheit erhalten geblieben.
Beitrag: Robert Schaper
Quelle:
Helmstedter Altstadt-Brief
Ausgabe: 1 / 2025
Herbert Rohm
Seit dem 22.02.2025 wurde diese Seite 18198 mal aufgerufen.